Markus Möstl, Michael Bäuerle (Hrsg.): Polizei- und Ordnungsrecht Hessen. Kommentar. 2. Auflage, München, C.H. Beck 2025, 1.059 Seiten, ISBN: 978-3-406-81846-2, 140.00 EUR
Rund fünf Jahre nach der 1. Auflage (2020) der Kommentierung zum hessischen Polizei- und Ordnungsrecht legen Möstl/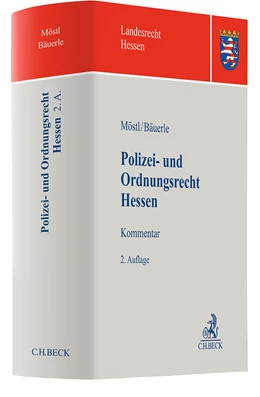 Bäuerle die 2. Auflage vor. Die Auflagenbezeichnungen beziehen sich auf die gedruckte Version, denn als Online-Kommentar steht das Werk bereits seit 2015 zur Verfügung. Ausschlaggebend für die Neuauflage waren sechs Gesetzespakete zum Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), die zur Änderung von 57 der 115 Paragrafen führten. Gegenüber der Vorlage ergibt das einen Zuwachs von 159 Seiten.
Bäuerle die 2. Auflage vor. Die Auflagenbezeichnungen beziehen sich auf die gedruckte Version, denn als Online-Kommentar steht das Werk bereits seit 2015 zur Verfügung. Ausschlaggebend für die Neuauflage waren sechs Gesetzespakete zum Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), die zur Änderung von 57 der 115 Paragrafen führten. Gegenüber der Vorlage ergibt das einen Zuwachs von 159 Seiten.
Herausgeber des Kommentars sind Prof. Dr. Markus Möstl (Universität Bayreuth) und Prof. Dr. Michael Bäuerle (Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit). Der Aufbau des Kommentars folgt der Struktur des HSOG. Vorgeschaltet sind „Vorbemerkungen zum Polizeirecht in Deutschland“ (S. 1-58), Ausführungen zu „Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen“ (S. 59-70) und eine Einführung in die Datenschutz-Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-RL) (S. 71-89). Den Rahmen bildet ein Bearbeiterverzeichnis, das Vorwort zur 2. Auflage, ein Literaturverzeichnis sowie – am Ende des Kommentars – ein 26,5-seitiges Sachverzeichnis. Nach dem Abdruck der jeweiligen Norm des HSOG folgt eine (meist auszugsweise) Wiedergabe der Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (VVHSOG). Eine anschließende Inhaltsübersicht bietet eine gute Orientierung über die kommentierten Themen. Am unteren Ende jeder Seite ist der Name des Bearbeiters bzw. der Bearbeiterin genannt.
Da es zu weit führen würde, die Kommentierung aller 115 Paragrafen zu analysieren, folgt ein Rekurs auf ausgewählte Inhalte und Normen. Mit der 1. Auflage ist es den Herausgebern auf Anhieb gelungen, einen soliden Kommentar vorzulegen. Die Bewertung der 2. Auflage kann sich auf einen kritischen Blick auf ggf. noch vorhandene Änderungspotenziale reduzieren.
Die „Vorbemerkungen zum Polizeirecht in Deutschland“ erfuhren eine nennenswerte Erweiterung angesichts der Entwicklung bei Rechtsprechung und Gesetzgebung i.Z.m. der drohenden Gefahr (S. 19 ff). Demgegenüber erscheint es als Banalität, wenn Möstl an anderer Stelle in diesem Kapitel auf vier Bundesländer hinweist, in denen das polizeiliche Einheitssystem gelten soll, ohne diese Länder, mit Ausnahme von Baden-Württemberg, zu nennen (S. 35). Soweit mit diesen Ausnahmen Baden-Württemberg, Bremen, Sachsen und Saarland gemeint sind, wäre hinter dem Freistaat Sachsen inzwischen ein Fragezeichen zu stellen (vgl. Sächsischer Landtag 2018: 233, 237). Allerdings wäre ohnehin zu diskutieren, welche Effekte noch mit der Differenzierung nach einem Einheits- bzw. Trennungssystem verbunden sind, die über bloße Begriffe hinausgehen.
Das der Kommentierung ebenfalls vorgeschaltete Kapitel „Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen“ ist eine Übersicht der Gesetzänderungen seit der 1. Auflage zu entnehmen. Hervorzuheben ist die Kritik an der letzten Novelle (2024) aus formell-verfassungsrechtlichen Gründen (S. 64). Die vorgebrachte Kritik ist anschlussfähig an die Forderung des Nationalen Normenkontrollrats in Bezug auf wirksame und effiziente Gesetze als Grundlage guten Regierens (vgl. Nationaler Normenkontrollrat 2022: 5, 25 ff.). Wichtig ist der Hinweis auf die Skandalisierung des Begriffs der „Ordnungspolizei“ im HSOG (S. 70, Rn. 63). Die zurecht geführte kritische Diskussion um den NS-Bezug lässt wiederholt – und so auch an dieser Stelle – außer Acht, dass es bereits während der Weimarer Republik eine Ordnungspolizei gab (vgl. Leßmann-Faust 1996: 20 f.).
Die mit dem „Gesetz zur Stärkung der Inneren Sicherheit in Hessen“ vorgenommenen Änderungen der §§ 1 Abs. 7, 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HSOG und die damit einhergehende Aufnahme des Sicherheitsempfindens als polizeiliche bzw. ordnungsbehördliche Aufgabe führte sowohl in der Sachverständigenanhörung als auch im seitdem veröffentlichten Schrifttum (vgl. Kalscheuer 2025; Roggan 2025) zu Kritik. Die Anmerkungen zu § 1 Abs. 7 HSOG (S. 124 f.) fallen vor diesem Hintergrund moderat aus. In Fortführung der Sachverständigenanhörung (bzw. auch der Gesetzesbegründung) beschränkt sich der Kommentar von Mühl/Fischer auf die rechtswissenschaftliche Perspektive, so dass wichtige kriminologische Aspekte zum Sicherheitsempfinden fehlen.
Auch die Ausführungen zur Videoüberwachung nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 HSOG (S. 324) bleiben trotz der Ungewöhnlichkeit dieser Norm eher unauffällig. Auf den Redaktionsschluss lässt sich das kaum begründen. Die 2. Auflage bringt den Kommentar auf den Stand 15. Februar 2025, so dass die Änderungen durch Art. 1 des „Gesetz zur Stärkung der Inneren Sicherheit in Hessen“ vom 13.12.2024 (GVBl. 2024, Nr. 83) eingearbeitet sind. Gleichwohl ging diese letzte Änderung des HSOG zügig vonstatten. Dem Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und SPD vom 01.10.2024 und den Sachverständigenanhörungen zwischen dem 08. und 12.11.2024 ließen die initiierenden Fraktionen am 05.12.2024 einen Änderungsantrag folgen. Nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt am 18.12.2024 traten die Gesetzänderungen am darauf folgenden Tag in Kraft. Gleichwohl hätte sich die Aufnahme gut begründeter Kritik aus der Sachverständigenanhörung angeboten. Auch abseits der Argumente der Sachverständigen beinhaltet der Gesetzentwurf einige Inkonsistenzen, die es hervorzuheben gilt (vgl. Lauber/Förg 2025).
Positiv zu nennen ist die Thematisierung unterschiedlicher Aspekte im Umgang mit Obdachlosigkeit, z.B. als polizeiliche Aufgabe (S. 98, Rn. 25.1), mit dem wichtigen Hinweis auf die eventuelle Nachrangigkeit des Polizei-/Ordnungsrechts ggü. dem Sozialrecht, oder in Bezug auf die Inanspruchnahme von Wohnraum (S. 748, Rn. 10). Allerdings sind nicht alle Fundstellen im Sachverzeichnis nachgewiesen.
Polizeiliche Befugnisse auf dem Gebiet der verdeckten Datenerhebung oder Fragen der Gefahrenbegriffe erzielen insbesondere in Fachkreisen und der Politik eine hohe Aufmerksamkeit. Für den schutzpolizeilichen bzw. ordnungsbehördlichen Alltag dominiert das Interesse an Fragen zu typischen Ermächtigungsgrundlagen wie z.B. der Sicherstellung. Bei der Kommentierung zu § 43 HSOG (Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten) und § 109 HSOG (Einnahmen) wären umfangreichere Ausführungen zu den Kosten nach Abschleppmaßnahmen wünschenswert, beispielsweise in Bezug auf die Standgebühren (vgl. exemplarisch OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.2.2014, I-1 U 86/13).
Nicht ausfindig gemacht werden konnten Ausführungen zu den nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wieder diskutierten Verantwortlichkeiten (Aufgaben) im Zusammenhang mit derartigen Veranstaltungen. Dabei könnte der Herausgeber durchaus auf eigene Arbeiten zurückgreifen, wie der Aufsatz zur „Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge bei Großveranstaltungen“ (Möstl/Lang 2024) zeigt.
Das Sachverzeichnis erfuhr eine bemerkenswerte Erweiterung von vormals knapp zehn Seiten auf nun 26,5 Seiten. Unter der Vielzahl an neu hinzugekommenen Begriffen sind exemplarisch zu erwähnen: Amokläufe, Annäherungsverbot, Arzt/Ärztin, Beliehene, Brechmittel, Elektronische Fußfessel, Forschung, Fußballfans, Gefährder, Gefährliche Tiere, IMSI-Catcher, Künstlicher Stau, Kriminalpräventionsräte, Landespräventionsrat, Mustererkennung, Polizeikessel, Polizeimissionen, Psychischer Ausnahmezustand, Virtuelle Währung, Waffenverbotszone oder Zivilschutz. Es verwundert jedoch, weshalb der Begriff „Sicherheitsempfinden“ (alternativ: Kriminalitätsfurcht) angesichts der o.a. Änderungen im HSOG nicht aufgenommen wurde. Bei dem Hinweis auf ein „nicht unerhebliches Diskriminierungspotential“ (S.486, RN 103) bei der Befugnis zur Identitätsfeststellung nach § 18 Abs. 2 Nr. 6 HSOG (sog. Schleierfahndung) hätte sich die Verwendung der Begriffe Racial oder Social Profiling angeboten, so wie auch bei den übrigen raumbezogenen Befugnissen zur Identitätsfeststellung. Konsequenterweise erscheint Racial Profiling auch nicht im Sachverzeichnis. Des Weiteren wird (weiterhin) der Begriff „Stadtpolizei“ vermisst sowie der Begriff „Kampfmittel“, wobei beide Begriffe in der Kommentierung erscheinen. Ein redaktionelles Versehen dürfte die Ausweisung der zwei Stichwörter „Surrogat“ und „Surrogate“ sein, zumal beide Begriffe auf die gleiche Norm (§ 43 HSOG) verweisen (S. 1053). Eine unnötige Doppelung ist auch bei den Begriffen „Unmittelbaren Zwang“ und „Unmittelbarer Zwang“ (S. 1054) bzw. „Weisungsbefugnis“ und „Weisungsbefugnisse“ (S. 1057) anzutreffen. Dass der Begriff „Veranstaltungen“ (S. 1055) nur auf die Meldeauflage des § 30a HSOG verweist, ist angesichts der kontroversen Diskussion um die Veranstaltungssicherheit bzw. das Vorhandensein eines Veranstaltungsrechts (als Teil des Polizei-/Ordnungsrechts) ein Manko. Einen geringen Nutzwert dürften Begriffe wie „Voraussetzungen“ (S. 1056) oder „Information“ (S. 1046) aufweisen.
Fazit
Auch die 2. Auflage der Kommentierung von Möstl/Bäuerle zum Polizei- und Ordnungsrecht Hessen ist eine empfehlenswerte Anschaffung. Besonders hervorzuheben sind die Vorbemerkungen zum Polizeirecht in Deutschland sowie die einleitenden Ausführungen zu „Entwicklung und Strukturen des Polizei- und Ordnungsrechts in Hessen“. Wer das Polizei- und Ordnungsrecht verstehen möchte, kommt nicht umhin, über die Entwicklung des Polizeirechts und der Institution Polizei informiert zu sein. Aufgrund der Besonderheiten im hessischen Polizeirecht, beispielsweise der in etlichen Städten vorhandenen kommunalen „Stadtpolizei“, wird das Buch auch kriminologisch und polizeiwissenschaftlich Interessierten empfohlen. Erfreulich ist die Erweiterung des Sachverzeichnisses. Ebenso nutzerfreundlich sind die Verweise auf Parallelvorschriften in anderen Bundesländern an etlichen Stellen des Kommentars. Die weiterhin vorhandene Wiedergabe der VVHSOG ist zu begrüßen, auch wenn diese Norm mangels eines Verlängerungserlasses ersatzlos außer Kraft getreten ist.
Vergleichbar der Vorauflage weist auch die 2. Auflage eine gute Herstellungsqualität auf. Aufgrund des Dünndrucks ist die 2. Auflage trotz der gestiegenen Seitenzahl schmaler als die Vorauflage und kommt zudem ohne Schutzumschlag aus. Dem Zuwachs von 159 Seiten steht leider ein Preisanstieg von vormals 109,00 EUR auf nun 149,00 EUR gegenüber. Wer einen Zugang zu Beck-Online hat, verfügt ggf. über einen Zugriff auf die digitale Version.
Karsten Lauber, August 2025
Verwendete Literatur
Kalscheuer, F. (2025): Wenn das Polizeirecht plötzlich Gefühle schützt, in: Legal Tribune Online. Verfügbar unter https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hessen-polizei-gesetz-sicherheitsgefuehl-verfassungswidrig-kriminalitaet-gefahr, abgerufen am 04.08.2025.
Lauber, K.; Förg, T. (2025): Zum Sicherheitsempfinden als polizeiliche Aufgabe, in: Landes- und Kommunalverwaltung, Nr. 5/2025, S. 193-199 (im Erscheinen).
Leßmann-Faust, P. (1996). Geschichte der Polizei, in: Michael Kniesel, Edwin Kube, Manfred Murck (Hrsg.), Handbuch für Führungskräfte der Polizei. Wissenschaft und Praxis. Lübeck, S. 9-40.
Möstl, M.; Lang, R. (2024): Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge bei Großveranstaltungen, in: Die Öffentliche Verwaltung (77), Nr. 18/2024, S. 761-770.
Nationaler Normenkontrollrat (Hrsg.) (2022): Jahresbericht 2022. Bürokratieabbau in der Zeitenwende. Verfügbar unter https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Fachpublikationen/2022_NKR_Jahresbericht.html, abgerufen am 23.08.2025.
Roggan, F. (2025): Die Videoüberwachung von „Angsträumen“. Zur Implementierung von Gefühlslagen in das (hessische) Polizeirecht, in: Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (44), Nr. 9/2025, S. 643–647.
Sächsischer Landtag (Hrsg.) (2018): Gesetz zur Neustrukturierung des Polizeirechtes des Freistaates Sachsen. Gesetzentwurf der Staatsregierung. Drucksache 6/14791.