Murray, Kenneth R., Haberfeld, Maria (Maki): Use of Force Training in Law Enforcement. A Reality Based Approach. Springer International Publishing Cham, 109 S., Softcover ISBN 978-3-030-59878-5, 53,49 Euro; eBook ISBN 978-3-030-59880-8, 39,99 Euro
Polizeiliches Gewalthandeln ist in den USA schon seit längerem Thema hitziger Diskussionen, in Deutschland spätestens seit der Studie von Tobias Singelnstein 2019/20 und der Ereignissen im Zusammenhang mit polizeilichen Übergriffen im vergangenen 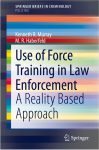 Jahr[1]. Murray und Haberfeld legen mit diesem Buch vor dem Hintergrund der Situation in den USA ein Konzept zum „Use of Force Training“ vor, also dazu, wie die rechtmäßige Anwendung von Polizeigewalt trainiert werden kann.
Jahr[1]. Murray und Haberfeld legen mit diesem Buch vor dem Hintergrund der Situation in den USA ein Konzept zum „Use of Force Training“ vor, also dazu, wie die rechtmäßige Anwendung von Polizeigewalt trainiert werden kann.
Dieser Ansatz kann auch vor dem Hintergrund, dass ein solches Training (wie Ausbildung generell) nur bedingt Auswirkungen auf polizeiliches Alltagshandeln hat, durchaus kritisiert werden, wie dies beispielsweise Vitale in seinem Buch „The End of Policing“ auf S. 4 ff. tut. Dafür sprechen verschiedene Aspekte, die alle mit den grundlegenden Problemen polizeilichen Handelns zu tun haben. Dazu gehört die grundlegende Ausrichtung von Polizeiarbeit, die Vitale als „“broken windows“-style policing“ beschreibt, „which targets low-level infractions for intensive, invasive, and aggressive enforcement“. Hinzu kommt ein „Borderline-Rassismus“ bei vielen Polizeibeamt*innen, über dessen Entstehung wir noch (nicht) genug wissen, dessen Auswirkungen aber in Deutschland 2020 erlebt werden konnten. Nicht zuletzt, und vielleicht zuvorderst, spielen Leitungsstrukturen und institutioneller Druck eine wichtige Rolle bei dem polizeilichen Alltagshandeln, vor allem dann, wenn es um Grenzbereiche zwischen legalem und nicht legalem Handeln geht.
Ungeachtet dessen kann polizeiliche Aus- und Fortbildung, wie wir bereits vor vielen Jahren feststellten[2], von der Kenntnis einer Eskalationsspirale profitieren, in dem sie bei den teilweise inkompatiblen Basiszielen (Autoritätserhalt, Eskalationsverbot), den Rahmenbedingungen (Organisation, Person, Situation) und/oder den offensichtlich entscheidenden Wahrnehmungsmustern (Kränkung, Ehrgefühl, Provokation) ansetzt. Auf diese Weise kann dem Ziel des zivilisatorischen Minimums der Gewaltanwendung auch und gerade auf Seiten der Träger des Monopols physischer Gewaltsamkeit ein Stück nähergekommen werden. Dazu muss man sachlich, objektiv und wissenschaftlich die Abläufe, die sich in Verbindung mit Gewaltanwendungen durch Polizeibeamte ereignen, analysieren, wie dies z.B. Stougton u.a.[3] getan haben – s. dazu meine Besprechung im PNL, in der ich auch darauf hingewiesen hatte, dass es dabei keinen Unterschied macht, dass sich diese Autoren auf die USA beziehen, zumindest nicht wenn es um taktische Überlegungen und Handlungsoptionen geht. Auch wenn die Ausbildung der amerikanischen Polizei eine andere ist (und die Anzahl der tödlichen Schüsse die in Deutschland um ein Vielfaches übersteigt): Vieles, was Stougton u.a. schreiben, ist 1:1 auf Deutschland übertragbar.
Murray und Haberfeld weisen zu Beginn ihres Buches darauf hin, dass „In the 1980s, demands escalated as sharp increases in violent crime led the public to support spending more money on local policing efforts. Police chiefs responded by experimenting with varying approaches, settling (for now) on “Community-Oriented Policing” as the “modern” approach to effective policing (…). Fast forward almost three decades and the expected changes did not take place, and the rift between the public and its police forces seems to be more serious than ever before” (S. 1). Dem kann man für die USA uneingeschränkt zustimmen; für Deutschland wird man die aktuelle Entwicklung abwarten müssen, die durchaus auch in diese Richtung zu gehen droht[4].
Die Frage ist daher, ob das „scenario-based use-of-force training”, wie es von Murray und Haberfeld in ihrem Buch vorgestellt wird, wirken kann und ob es auch für uns relevant sein kann.
Denn nach dem tragischen Tod von fünf Polizeibeamten in Dallas hat der dortige Polizeichef bereits 2016 folgendes gesagt: „We’re asking cops to do too much in this country. We are. Every societal failure, we put it off on the cops to solve. Not enough mental health funding, let the cops handle it… Here in Dallas we got a loose dog problem; let’s have the cops chase loose dogs. Schools fail, let’s give it to the cops That’s too much to ask. Policing was never meant to solve all those problems“[5]. Diese Überforderung der Polizei, unter dem Stichwort “Defund the Police” in den USA intensiv diskutiert, spielt bei uns eher nur am Rande eine Rolle; wohl auch, weil Polizeigewerkschaften zwar immer wieder diese Überforderung beklagen, statt aber dafür zu plädieren, Aufgaben abzugeben, wir lediglich und laut nach „mehr Personal“ gerufen. Zudem wurde hierzulange „Defund the Police“ immer als Forderung zur Abschaffung der Polizei verstanden – fälschlicherweise, denn: “Defund the police” means reallocating or redirecting funding away from the police department to other government agencies funded by the local municipality. That’s it. It’s that simple. Defund does not mean abolish policing”[6].
Vitale, der das Zitat des Polizeichefs aus Dallas aufgreift, kommentiert es in seinem Buch auf S. 28 wie folgt: “We are told that the police are the bringers of justice. They are here to help maintain social order so that no one should be subjected to abuse. The neutral enforcement of the law sets us all free. This understanding of policing, however, is largely mythical. American police function, despite whatever good intentions they have, as a tool for managing deeply entrenched inequalities in a way that systematically produces injustices for the poor, socially marginal, and non-white”.
Die Polizei, so seine Aussage, ist mehr damit beschäftigt, sich selbst und den status quo zu beschützen, als die grundlegenden Probleme zu benennen, geschweige denn anzugehen.
Wenn Murray und Haberfeld von dem Polizeibeamt*in als „Reluctant Warrior“ sprechen und gleichzeitig andeutet, dass Polizeibeamt*innen heute aufgrund ihrer Sozialisation in einer anderen Schicht möglicherweise daran gehindert sind, sich „angemessen“ mit gewaltbereiten Straftätern aus „unteren“ sozialen Schichten und/oder bestimmten Gebieten auseinanderzusetzen, so muss man hier durchaus die Frage stellen (und auch beantworten), ob und in wieweit dies auch für Deutschland zutrifft – allerdings in eine andere Richtung als die Autor*innen dies wohl glauben, wenn sie schreiben: “Internal administrative pressure, the looming specter of a lawsuit, and lack of understanding coupled with unrealistic expectations from society further contribute to an officer’s sense of reluctance and hesitation when rightfully called upon to resolve a violent encounter. This hesitation too often results in officer injury – or worse“ (S. 7).
Entsprechend beschäftigen sich die Autor*innen mit den “psychologischen Schwellen”, die Beamt*innen bei der Anwendung von Gewalt überschreiten müssen (S. 8 f.). Leider findet man nur in Kap. 3 (S. 17 ff.) einige Hinweise darauf, dass die psychologische Verfasstheit des Einsatzbeamt*in sich auch in einer anderen Richtung, nämlich negativ auf die Gewaltanwendung auswirken kann – indem zu viel und ungerechtfertigte Gewalt angewendet wird. Und dies auch eher indirekt. Eigentlich schade, denn dann wäre das Buch ausgewogen und objektiv geworden. So liegt der Schwerpunkt eindeutig einerseits auf dem Gebrauch der Schusswaffe und andererseits auf den Aspekten, die eine/n Beamt*in daran hindern könnten, diese einzusetzen.
So sind die Überlegungen zu den bisherigen Problemen des Schusswaffentrainings[7] (ab S. 9) durchaus zutreffend, aber leider greifen sie ebenso zu kurz wie die Ausführungen zu Augen-Hand-Koordination und zum Stress sowie zu den weiteren Folgen einer Situation, in der ein Schusswaffengebraucht möglich oder nötig ist (S. 17 ff.). Dies alles ist wichtig, aber kann (zumindest in Deutschland) als bekannt vorausgesetzt werden.
Ab Kapitel 4 (S. 25 ff.) geht es dann im das „scenario-based training“, und dieses Kapitel beginnt damit, dass von „Killing „enabling Factors“ die Rede ist, sowie von der Prädisposition des „Killers“. Damit wird deutlich, welches Bild die Autor*innen von der Person haben, gegenüber der die Schusswaffen gebraucht wird: Es geht um den „Killer“, die Person, die wissentlich und absichtlich jemanden (vor allem den/die Polizeibeamt*in) töten will. Zumindest für Deutschland können wir davon ausgehen, dass solche Interaktionen mit „Killern“ die absolute Ausnahme darstellen; die Gruppe von Menschen, die am häufigsten Opfer polizeilichen Schusswaffengebrauchs wird, sind psychisch Gestörte[8]. In dem Buch von Murray und Haberfeld ist da vom „lack of rational problem-solving“ (S. 69) die Rede, ohne auch nur ansatzweise auf die auch und gerade in den USA besonders stark bestehenden Probleme im Umgang mit psychisch gestörten Personen einzugehen.
Im Kapitel 7 (ab S. 79) wird dann ein „neuer Weg“ des Schusswaffentrainings vorgestellt, wobei die „alte“ Philosophie einer „neuen“ gegenübergestellt wird. Das ist durchaus verdienstvoll, und wird auch in den sog. „Building Blocks of Reality-Based Training“ (ab S. 81) verdeutlicht. Sie sehen so aus (S. 82):
- Define your own reality.
- Use situations your officers are likely to encounter.
- Look for patterns of behavior in your agency’s case files.
- Change endings to avoid programmed responses.
- Set up and enforce strict safety guidelines.
- If your standard is perfection, your students will be excellent.
- Unsafe training practices tend to magnify themselves in the real world.
- Observe and correct all unsafe behaviors.
- Train within agency policy.
- Reality-Based Training will bring to light issues for clarification by administration.
- Play “What if?” in training and fix problems before they occur in real situations.
- Professionals must have pre-conditioned responses to stressful events.
- Make training realistic.
- Use realistic props and training versions of equipment.
- Use realistic settings.
- Use realistic situations.
- Make training stressful.
- Teach from the simple to the complex to ensure competency.
- Reality-Based Training requires judgment and teaches situational awareness.
- Learn to accept and channel the effects of stress.
- Train officers to win.
- Do not give it away.
- Stop “killing” your students in training.
- The problem with negative reinforcement training
Nicht nur an dieser Stelle in dem Buch muss man den Eindruck eines nicht oder unvollständig durchgeführten Lektorates haben, den Punkt 1. Wird am Ende noch einmal wiederholt. Es mag sein, dass dies (nur) in der pdf-Version der Fall ist, die dem Rezensenten vorlag; in jedem Fall sollte der (renommierte) Springer-Verlag dies prüfen.
Positiv sind in jedem Fall die Hinweise für Einsatztrainer*innen, die ab S. 84 gegeben werden. Diese dürften, wenn auch in abgewandelter Form, auch für unsere Situation anwendbar sein. Ebenso die Hinweise zum „Debriefing, Remadiation und After Action Review“ (S. 97 ff.). Der Hinweis der Autor*innen auf S. 101: „Reality-Based Training is a complicated undertaking, and to believe that you can jump right into it by purchasing some equipment and taking a day or two to sketch out a few scenarios is exactly how most agencies begin, and ultimately why accidents or poor quality training occurs” macht noch einmal deutlich, wo möglicherweise die Unterschiede in den Ausgangssituationen zwischen den USA und Deutschland in Bezug auf die Aus- und Fortbildung der Polizeibeamt*innen liegen. Wenn man dies bei der Lektüre des Buches berücksichtigt, dann kann man die insgesamt rund 100 Seiten durchaus auch mit Gewinn lesen. Als Vorlage oder Muster für das Einsatz- und Schießtraining in Deutschland taugt das Buch leider nicht.
Thomas Feltes, Januar 2021
[1] Vgl. dazu die Chronologie der Ereignisse 2020 von Otto Diederichs in Feltes/Plank: Rassismus, Rechtsextremismus, Polizeigewalt. Beiträge für und über eine rechtschaffen(d)e, demokratische Bürgerpolizei, Frankfurt 2021 (Verlag für Polizeiwissenschaft, erscheint im März 2021).
[2] In unserem internationalen Projekt “Police Use of Force”; vgl. Feltes/Klukkert/Ohlemacher: „…, dann habe ich ihm auch schon eine geschmiert.“ Autoritätserhalt und Eskalationsangst als Ursachen polizeilicher Gewaltausübung. In: MSchrKrim 4/ 2007, S. 285-303.
[3] Seth W. Stoughton, Jeffrey J. Noble, Geoffrey P. Alpert: Evaluating Police Uses of Force. New York, New York University Press, 2020.
[4] Vgl. Thomas Feltes, Hoger Plank: Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei? Ein Beitrag für und über eine „rechtschaffen(d)e“, demokratische (Bürger-)Polizei. Online-Dokument. Die jeweils aktuelle Version ist hier verfügbar.
[5] Der Beitrag ist hier verfügbar.
[6] Rashawn Ray: What does ‘defund the police’ mean and does it have merit?
[7] Auch im englischen gibt es die Unterscheidung zwischen „Training“ und „Education“; darauf gehen die Autor*innen leider nicht ein und erwecken so den Eindruck, dass man etwas „trainieren“ kann; dabei wäre gerade im Bereich der polizeilichen Gewaltanwendung und insbesondere beim Schusswaffengebrauch mehr als (technisches) Training notwendig. Es braucht eine Erziehung zu angemessenem polizeilichem Verhalten, wie ich dies in meinem Beitrag „Polizeigewalt – die individuelle Perspektive“ beschrieben habe, der demnächst im Handbuch Einsatztraining: Professionelles Konfliktmanagement für Polizist*innen“, hrsg. von Mario S. Staller und Swen Körner erscheinen wird. Vorab ist der Beitrag hier in unredigierter Fassung verfügbar:
[8] S. dazu den Beitrag von Michael Alex und mir: Polizeieinsätze in Verbindung mit psychisch kranken Menschen. Erscheint 2021 in dem o.gen. Handbuch, vorab hier verfügbar.