Nadine Jukschat , Katharina Leimbach, Carolin Neubert (Hrsg.): Qualitative Kriminologie, quo vadis? Stand, Herausforderungen und Perspektiven qualitativer Forschung in der Kriminologie. Beltz Juventa, Weinheim Basel, 2022. 239 Seiten, 29,95 €. Print ISBN 978-3-7799-6449-0; E-Book (PDF) ISBN 978-3-7799-5764-5
Motiviert von ihren wissenschaftsbiographischen Erfahrungen ist es der Autorinnen – Nadine Jukschat, Katarina Leimbach, Carolin Neubert – Anliegen, mithilfe dieses Sammelbandes die „qualitative Kriminologie“, vor allem in der Forschungslandschaft 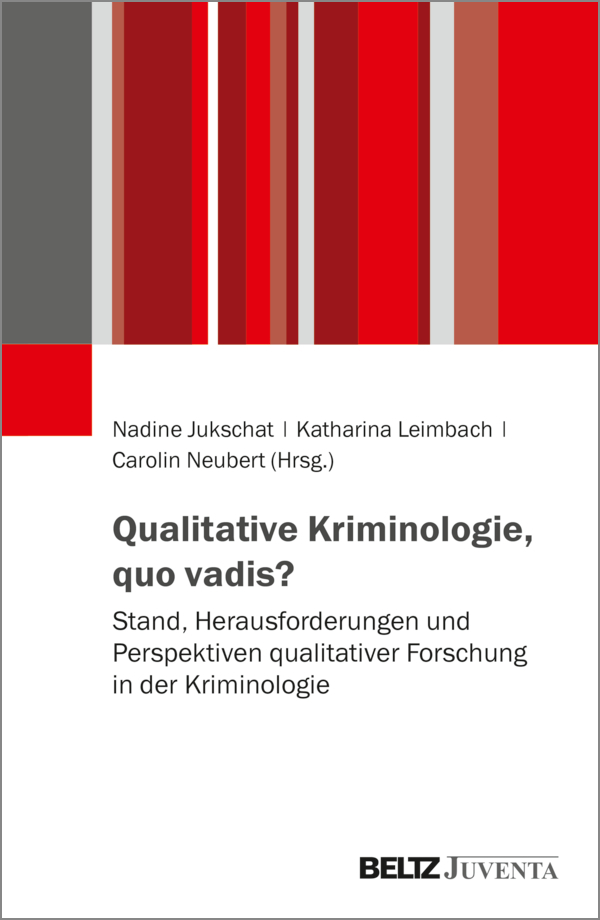 Deutschland, zu konturieren, sie folglich in einem Konzept zu verorten, damit sie „(…) in ihrer historischen und aktuellen Bedeutung sichtbar und auch präsenter (…)“ (S. 11) und damit unweigerlich auch gestärkt wird. Die Autorinnen wollen Begriffsarbeit leisten (vgl. S. 20) sowie für die Herausforderungen einer qualitativen Kriminologie sensibilisieren, indem sie „einen vertieften methodologischen Diskurs und Auseinandersetzungen mit den für qualitativ-kriminologische Forschung spezifischen Herausforderungen anstoßen“ (S. 19). So organisierten sie eine gleichlautende Tagung am KFN, starteten einen Publikationsaufruf und veröffentlichten diesen Sammelband, den sie selbst als „(…) Versuch einer Rekonstruktion des qualitativ-kriminologisch forschenden (Wissenschafts-)Feldes lesen – mit zentralen Forschungsgegenständen, Debatten und methodologischen Positionen im Sinne von Feldkonzepten.“ (S. 20).
Deutschland, zu konturieren, sie folglich in einem Konzept zu verorten, damit sie „(…) in ihrer historischen und aktuellen Bedeutung sichtbar und auch präsenter (…)“ (S. 11) und damit unweigerlich auch gestärkt wird. Die Autorinnen wollen Begriffsarbeit leisten (vgl. S. 20) sowie für die Herausforderungen einer qualitativen Kriminologie sensibilisieren, indem sie „einen vertieften methodologischen Diskurs und Auseinandersetzungen mit den für qualitativ-kriminologische Forschung spezifischen Herausforderungen anstoßen“ (S. 19). So organisierten sie eine gleichlautende Tagung am KFN, starteten einen Publikationsaufruf und veröffentlichten diesen Sammelband, den sie selbst als „(…) Versuch einer Rekonstruktion des qualitativ-kriminologisch forschenden (Wissenschafts-)Feldes lesen – mit zentralen Forschungsgegenständen, Debatten und methodologischen Positionen im Sinne von Feldkonzepten.“ (S. 20).
Im einleitenden Beitrag „Qualitative Kriminologie: Ein Konzeptversuch“ benennen Jukschat, Leimbach, Neubert neben historischen Ausgangspunkten und Einflüssen, all jene Herausforderungen, mit denen sich qualitativ, vor allem qualitativ-rekonstruktiv arbeitende Forschende in der Ausübung ihrer Arbeit konfrontiert sehen: Sie benennen strukturelle Widerstände, betonen die Notwendigkeit einer konzeptionellen Begriffsarbeit, kritisieren die stark eingeschränkte Sichtbarkeit, mangelnde Anerkennung, eine fehlende institutionelle Organisation, die zunehmende Abhängigkeit von einer Verwertungslogik folgenden Drittmittelförderung sowie den Publikationsdruck, der einer zeitintensiven rekonstruktiven Auswertung entgegensteht. Zudem sehen sie, dass eine von der Inter- und Multidisziplinarität ihrer Bezugswissenschaften lebende Kriminologie, durch ihre institutionelle rechtswissenschaftliche Verankerung (im deutschsprachigen Raum), in ihrer Ausrichtung entsprechend geleitet aber auch eingeschränkt wird. So erzeugt diese Verankerung „(…) eine hegemoniale Blick- und Denkrichtung auf kriminologische Fragestellungen, nämlich vor allem eine (straf-)rechtliche und letztlich häufig auch eine anwendungsorientierte, welche die Kriminalität zudem tendenziell ätiologisch und ontologisch denkt“ (S. 16).
Den Autorinnen ist absolut zuzustimmen: Es ist genau diese eingeschränkte, in Teilen komplexitätsreduzierende Sicht- und Denkweise, die der für diesen Forschungsbereich notwendigen Offenheit widerspricht. Denn nur durch eben diese Offenheit und Reflexionsprozesse können hochkomplexe gesellschaftliche Zusammenhänge und Abläufe sowie Sinnstrukturen, die von Dynamiken, Denkmustern, Stereotypisierungen, der eigenen Standortgebundenheit bedingt und geprägt sind, angemessen rekonstruiert und erforscht werden. Eine über numerische Komponenten hinausgehende, für die kriminologische Forschung unabdingbare Notwendigkeit.
Der Sammelband umfasst 239 Seiten und wurde in drei große Themenkomplexe aufgeteilt, in welche die Autorinnen jeweils kurz und prägnant einführen. I. Standortgebundenheit, Normativität und Reflexivität (S. 25-84); II. Repräsentativität und Generalisierbarkeit (S. 85-179); III. Gesellschaftlicher Kontext und Erwartungsstrukturen (S. 181-237). Überschaubarerweise finden sich zu jedem thematischen Abschnitt drei bzw. vier Beiträge, die sich in der Auseinandersetzung mit eigenen Forschungsprojekten mit den relevanten Fragestellungen beschäftigen. Dadurch leisten sie einen wertvollen Beitrag und setzen spannende und wichtige Impulse für Theorie und Praxis.
Die Beiträge des ersten Themenkomplexes – I. Standortgebundenheit, Normativität und Reflexivität – , verfasst von Holger Schmidt (S. 28-48), Barbara Sieferle (S. 49-66) und Philipp Müller (S. 67-84), befassen sich dabei mit den großen Fragen der Umsetzbarkeit von Werturteilsfreiheit und Objektivität in qualitativer Forschung, wobei zunächst ernüchternd festgestellt wird, dass Reflexivität in der hiesigen kriminologischen Forschung kaum Einzug gehalten hat (vgl. S. 28, 45) bzw. Reflexivitätsverständnisse unterschiedlich ausfallen und entsprechend unterschiedlich in der Forschung Anwendung finden (vgl. S. 31, 32). Dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, wird ein offensiver, etwas optimistischerer, anerkennender Umgang mit unweigerlich vorhandener Subjektivität, sozialer Situiertheit sowie soziokultureller Positionierung gefordert, um deren epistemologisches sowie erkenntnisförderndes Potential zu erkennen. Anhand von forschungserfahrungsbasierten Beispielen wird diese Forderung konkret umgesetzt und gleichzeitig veranschaulicht. Hierbei kommen – die Autor*innen sind sich der Kritiken und Leerstellen durchaus auch bewusst – unterschiedliche Ansätze und Zugänge zum Einsatz: So beschäftigt sich Schmidt bspw. in seinem Beitrag mit einer interaktions-, konstruktionstheoretischen Analyse und kombiniert diese mit biographieanalytischen Ansätzen. Hierbei weicht er bewusst „(…) von den Konventionen akademischen Schreibens (…)“ (S. 28 f.) ab, wodurch Reflexivität fast erlebbar wird und er den „(…) teils widersprüchlichen Anforderungen von Reflexivität (…)“ (S. 28) durchaus gerecht wird. Die Leserschaft profitiert unweigerlich von dieser Strategie und dem in Teilen subtilen Humor des Autors.
Die Beiträge des zweiten Themenkomplexes „II Repräsentativität und Generalisierbarkeit“ – verfasst von Helena Schüttler und Carolin Neubert (S. 88-113), Dirk Lampe (S. 114-141), Katharina Friederike Sträter und Sebastian Rhein (S. 142-168) und Andreas Böttger (S. 169-178) – beschäftigen sich mit diesen aus der quantitativen Methodologie stammenden Begrifflichkeiten, welchen qualitativ Forschende häufig argumentativ bis konfrontativ begegnen müssen; oder sollen? Darin kann mal wohl ein Indiz erkennen, dass die Denkstrukturen (vor allem) des Zielpublikums immer noch von numerischen Komponenten quantitativer Forschung durchzogen sind oder aber, dass die Postulate qualitativer Forschung nicht in der gesamten Forschungswelt Anerkennung finden. So ist es wohl notwendig, dass – wovon diese Beiträge handeln – es ein qualitatives Verständnis geben muss, nach welchem es um die Bildung von Ideal- nicht Durchschnittstypen geht oder generalisierbare Aussagen durchaus mittels qualitativer Forschungsmethoden getroffen werden können (vgl. S. 85, 86) bzw. es geht darum, den Erkenntnisgewinn qualitativer kriminologischer Forschung einfach nur anzuerkennen (vgl. S. 169). Denn erst durch den Einsatz sensibler Konzepte können gewisse Feinheiten und Ambiguitäten überhaupt erst erkannt oder unbekannte Kategorien exploriert werden (vgl. S. 159, 160). Doch die Autoren*innen sprechen sich auch und vor allem für Methodenpluralismus und multiparadigmatische Ansätze, eine Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden aus (vgl. u. a. S. 136) – die explizite Beschäftigung mit den diesem Themenkomplex gebenden Begrifflichkeiten bleibt in manchen Beiträgen hingegen etwas marginal – bzw. dafür, und das ist natürlich essentiell, dass die Wahl der Methode vom Forschungsinteresse bestimmt werden muss und dem Gegenstand angemessen sein muss.
Gerade diesbzgl. lässt sich leider häufig feststellen, dass in meist unter Zeitdruck gefertigten kriminologischen Masterarbeiten, der Grund für die Wahl qualitativer Methoden paradoxerweise maßgeblich vom Faktor Zeit und weniger vom Forschungsinteresse bestimmt wird, auch wenn gerade der Zeitfaktor in der Fachwelt als Hemmschuh für die Durchführung qualitativer, vor allem rekonstruktiver Forschung, angesehen wird. Argumentativ steht hier jedoch die Akzeptanz einer geringen Anzahl an Untersuchungsobjekten qualitativer Forschung, den einzuhaltenden Gütekriterien Repräsentativität und Generalisierbarkeit quantitativer Forschungen gegenüber. Und hier sehen die Studierenden den Vorteil qualitativer Untersuchungen. Denn nur allzu oft finden sich in diesen Arbeiten entsprechende Begründungen bis hin zu Entschuldigungen für die geringe Größe des Samples und der damit verbundenen fehlenden Generalisierbarkeit oder fehlenden Möglichkeiten, kausale Aussagen zu treffen. Die Entscheidung für den Einsatz von qualitativer oder quantitativer Methoden – und darin ist den Autor*innen uneingeschränkt zuzustimmen – sollte nicht vom Ziel abhängen, generalisierbare Aussagen zu treffen, sondern davon, ob Phänomene gemessen (quantitativ) oder verstanden (qualitativ) werden sollen (vgl. S. 178). Sensibilisierungsarbeit in methodologischer Hinsicht muss unbedingt geleistet werden.
Die Aufsätze des letzten Themenkomplexes „III. Gesellschaftlicher Kontext und Erwartungsstrukturen“ werden von Nicole Bögelein (S. 184-199), Martin Herrnkind und Marschel Schöne (S. 200-218) sowie Folke Brodersen (S. 219-237) verfasst. Hierbei geht es darum, dass jede wissenschaftliche Forschung von feldimmanenten Logiken und spezifischen Erwartungsstrukturen des/der Forschenden und des/der Beforschten und den jeweils diese umgebenden, darin herrschenden gesellschaftlichen Bestimmungen und Bedingungen geformt werden. Es geht also um das „Verstehen des Verstehens“ (S. 181), was qualitative, rekonstruktive Verfahren zu leisten vermögen. Forschungsanliegen müssen folglich bereits zu Beginn der Untersuchung richtig und transparent kommuniziert werden, um gewissen Erwartungshaltungen bereits im Vorfeld realistisch zu begegnen, so Bögelein (vgl. S. 196).
Doch dass es nicht immer einfach ist, transparent argumentativ den Feld- und Forschungszugang zu erhalten, kommt vor allem in der polizeiwissenschaftlichen Forschung zum Tragen. Welche Spannungsfelder und Kräfte auf den Forschungsbereich um und über die Polizei nun wie eine „Art Wissenschafts-Firewall“ (S. 201) wirken, werden anhand des Bourdieuschen Feld-Habitus-Modells analysiert. Überzeugungsarbeit muss also besonders hier geleistet werden und detaillierte Kenntnisse der strukturellen wie habituellen Besonderheiten der Untersuchungsfelder sollen dazu förderlich sein (vgl. S. 215). So ist es: nur auf bekannte Ängste und Befürchtungen des zu erforschenden Feldes kann angemessen reagiert werden. Der Aufsatz der Polizeiwissenschaftler Herrnkind und Schöne leistet einen entsprechenden Beitrag.
Aber auch sonst treffen Forscher*innen immer wieder auf Schwierigkeiten im Feldzugang und bei der Datenerhebung. Besonders wenn es um die Erforschung von problematisierten Adressat*innen geht, die sich in „‘absoluten‘ Diskursen“ (S. 219, vgl. S. 220, 221) befinden, deren Aktionsfelder sowie Wissensordnungen von hegemonialen Denkstrukturen und Diskursorganisationen durchzogen sind (vgl. S. 224, 225): im Bereich der Pädophilie dominieren bspw. therapeutische Wissensordnungen (vgl. S. 224), im Bereich Radikalisierung dominiert die Sicherheitsperspektive. Wie man Forschung innerhalb von und über ‚absolute‘ Diskurse mittels qualitativer Forschung produktiv betreiben kann, wird im Beitrag Brodersen verdeutlicht (vgl. S.234). Gerade hier müssen das Prinzip der Offenheit, die Fähigkeit der Selbstreflexion und die Orientierung am Feld dringlich eingehalten werden (vgl. S. 234). Diese hegemonialen Perspektiven müssen nämlich als irritierend angesehen und kritisch, reflexiv hinterfragt werden. Nur so können gewisse dem Material anhaftende Sinn- und Entscheidungsstrukturen als soziale Konstrukte erkannt und hinterfragt und ein besseres Verständnis der Forschungsgegenstände erzielt werden sowie – und das ist von immenser Bedeutung – verhindert werden, dass wissenschaftliche Forschung sich unkritisch für gewisse politische Zwecke instrumentalisieren lässt.
Bei dem Buch handelt es sich also nicht um ein klassisches Einführungswerk in die Methodiken der qualitativen Sozialforschung oder um einen Methodenstreit vom Zaun brechenden Sammelband. Vielmehr richten sich die Autor*innen an eine methodisch bereits geschulte Leserschaft, die das Buch als anwendungsorientierte Handreichung verstehen kann. Das im Buch vermittelte Wissen und die beschriebenen Erfahrung im Umgang mit forschungs- oder feldimmanenten Herausforderungen oder Schwierigkeiten, kann und soll für die eigene Forschung fruchtbar gemacht, angewandt und umgesetzt werden. Dies ist ein erster und wichtiger Schritt in Richtung der Konzeptualisierung sowie Systematisierung einer „qualitativen Kriminologie“.
Der Sammelband eignet sich allerdings nicht nur für all jene, die explorativ forschen und ihr methodisches qualitatives Wissen vertiefen und stärken wollen, sondern auch für all jene, die der qualitativen Kriminologie kritisch gegenüber stehen, welche immer noch in den quantitativen Methoden das Maß aller Dinge wähnen. Diese können anhand des Sammelbandes durchaus erkennen, wie bereichernd und effizient ein Methodenpluralismus ist.
Das Werk sollte im Methodendiskurs folglich nicht unerwähnt bleiben.
Die „Angaben zu den Autor*innen“ (S. 238 f.) finden sich am Ende des Bandes, sind alphabetisch gelistet und beinhalten Auskünfte zu den theoretischen sowie praktischen Arbeitsbereichen und Arbeitsschwerpunkten.
Ruth Sapelza, München, Mai 2022